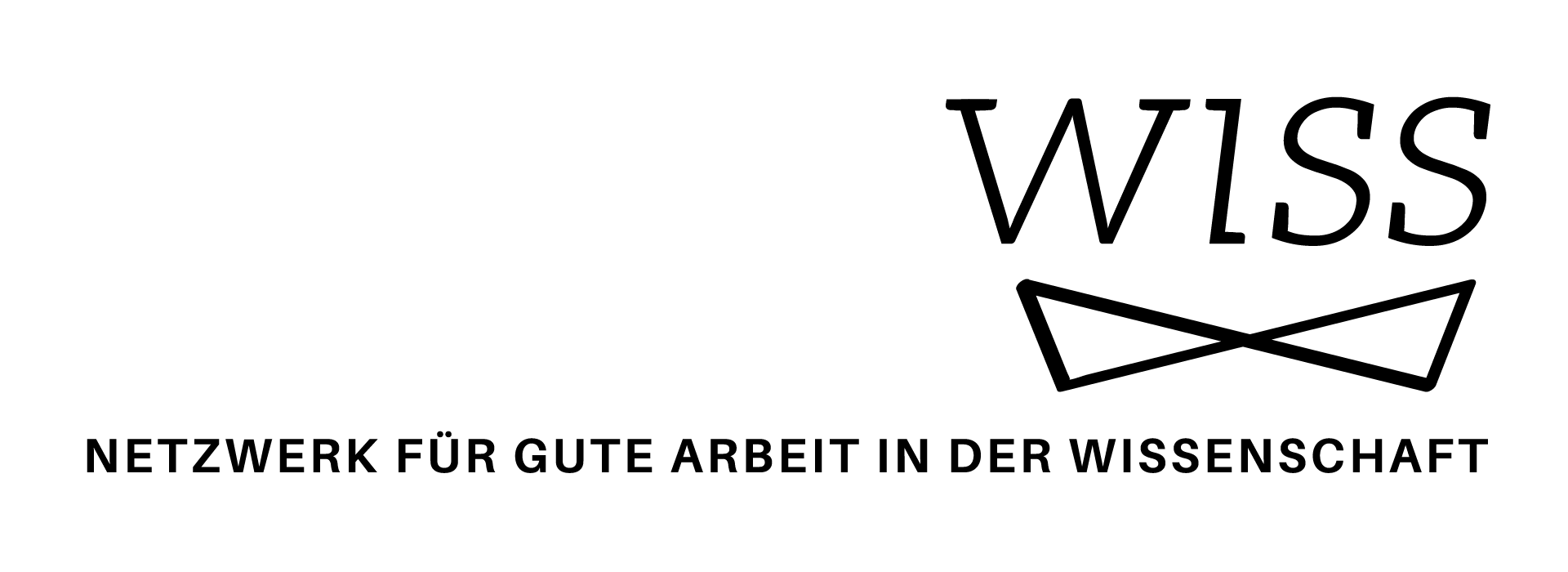Über Wissenschaftsfreiheit wird in jüngster Zeit wieder vermehrt diskutiert. Während man in der Regierung stolz auf beste Werte Deutschlands in international vergleichenden Studien dazu verweist, inwiefern staatliche Strukturen freie Wissenschaft ermöglichen oder behindern, wird vonseiten mancher Wissenschaftler:innen die Gefährdung der Wissenschaftsfreiheit durch eine sogenannte „Cancel Culture“ behauptet. Wir möchten uns in dieser Debatte zu Wort melden, weil wir glauben, dass keine der beiden Positionierungen die Realität (und die durchaus vorhandenen Gefahren) plausibel abbildet – und weil wir es angesichts der wachsenden Bedrohungen der Demokratie auch hierzulande für dringend geboten halten, dieses Thema anzusprechen. Denn Wissenschaftsfreiheit ist nicht nur eine Freiheit, die durch den demokratischen Rechtsstaat ermöglicht und garantiert wird; sie gehört ihrerseits zu den Bedingungen einer funktionierenden Demokratie.
Demokratischer und wissenschaftlicher Diskurs teilen eine basale Eigenschaft: Beide bilden Formen des Sprechens, in denen, mit Bezug auf überprüfbare Sachverhalte, das bessere Argument und nicht allein die Position zählen soll, aus der gesprochen wird. Beide müssen daher daran interessiert sein, dass zuverlässige Verfahren der Ermittlung von Fakten existieren und dass die kollektive Verständigung nicht von Herrschaftsstrukturen durchsetzt ist, die die Wahrheits- oder Entscheidungsfindung behindern; beide müssen einen Modus finden, der grundsätzlich nicht nur zu Kritik einlädt und sie so hörbar wie möglich macht, sondern sich zugleich gegen diskreditierende und diffamierende Formen von Pseudokritik immunisiert, deren Ziel nicht Erkenntnis, sondern die Stabilisierung oder Implementierung von Herrschaftsverhältnissen ist. In diesem Sinn sollte die universitas, die Gemeinschaft der Forschenden, nicht nur Wissensressourcen für den demokratischen Rechtsstaat bereitstellen, sondern außer einem Wissens- auch selbst ein Demokratielabor sein. Wissenschaftsfreiheit profitiert nicht nur von demokratischer Kultur, sie befördert auch deren Erhaltung.
Daher reicht es nicht, zu fragen, ob der Staat in die inhaltliche Ausgestaltung von Forschungsprogrammen hineinregiere oder nicht, und es ist prinzipiell weder gut noch schlecht, wenn kritische Haltungen und politisches Engagement auch wissenschaftliche Debatten prägen. Die entscheidende Frage, die im Verhältnis von Demokratie und Wissenschaftsfreiheit gestellt werden muss, lautet vielmehr: Stellen unsere Hochschulen und Forschungseinrichtungen in ihrer institutionellen Verfasstheit Räume bereit, in denen Wahrheitsfindung und Kritik sich im notwendigen Maß frei entfalten können?
Wissenschaftsfreiheit trotz prekärer Anstellung?
Daran sind Zweifel erlaubt. Bekanntermaßen beruht das deutsche Wissenschaftssystem auf dem quasi feudalistischen Prinzip, einem extrem kleinen Anteil ihrer Beschäftigten, zumeist Professor:innen, eine sichere Position vorzubehalten, während das Gros der wissenschaftlich Beschäftigten nicht nur befristet angestellt ist, sondern zudem an die Weisungen der Professor:innen gebunden und von deren Protektion abhängig ist. Die Mehrheit der wissenschaftlich Tätigen genießt schon deshalb keine volle Wissenschaftsfreiheit, weil ihre Anstellungsverhältnisse die Anpassung an die Forschungsagenden der happy few erfordern, die über Sicherheit, Macht und Einfluss verfügen. Eine repräsentative Studie hat ergeben, dass sich besonders befristet beschäftigte Wissenschaftler:innen auf Veranstaltungen und in Publikationen mit wissenschaftlicher Kritik zurückhalten, „weil sie sich zukünftige Beschäftigungsperspektiven oder Karrierechancen nicht verbauen wollen“. Zur entsprechenden Aussage gaben 39% der befristet Beschäftigten, aber nur 27% der Dauerbeschäftigten „Immer“, „Häufig“ oder „Teilweise“ an.[1] Dieselben befristet Beschäftigten sind aber auch in den Strukturen akademischer Selbstverwaltung schlecht repräsentiert, und der existenzielle Druck, der auf ihnen lastet, zwingt sie, ihre zeitlichen Ressourcen nicht in die Interessenvertretung als Gruppe und in den Aufbau einer demokratischen institutionellen Kultur, sondern in Forschungsoutputs und die Absicherung ihrer materiellen Lage zu investieren, d.h. Drittmittelerfolge zu erzielen und Positionen mit größerem symbolischem Kapital zu erhalten, die die ‚Überlebenswahrscheinlichkeit‘ in einem auf erbarmungslose Auslese getrimmten System erhöhen. Nicht allein aufgrund der Regelungen zur Professor:innenmehrheit, die einer proportional sehr kleinen Beschäftigtengruppe die meisten Rechte einräumen, sondern auch aufgrund karrierepraktischer Behinderungen verfügt der größte Teil der wissenschaftlich Tätigen auf institutioneller Ebene über wenig Mitbestimmung. Deren Gewicht ist in dem Maß geschrumpft, in dem Forschungsförderung in den letzten Jahrzehnten in den Drittmittelbereich verschoben wurde: So wurde der Anteil des prekären Personals erhöht und zugleich dessen Unterordnung unter die Forschungsagenden der Professor:innenschaft verstärkt.
Resilienz gegen den Rechtsruck trotz neoliberaler Entdemokratisierung?
Die Neoliberalisierung der Hochschulgovernance, in deren Zug diese Entwicklung stattfand, verfolgt in bestimmten Hinsichten eine offen antidemokratische Agenda: Hochschulen sollen wie Unternehmen geführt werden. Deshalb wurden – etwa zur gleichen Zeit, in der die Exzellenzinitiative implementiert wurde – Machtverschiebungen auch auf Ebene der Hochschulleitungen vorgenommen; interne Mitbestimmungsstrukturen wurden gezielt dadurch geschwächt, dass Steuerungskompetenzen an externe Hochschulräte verlagert wurden. Dieter Imboden, der Evaluator der Exzellenzinitiative, scheute sich nicht, deutschen Universitäten ein „falsch verstandenes Demokratiebedürfnis“ zu attestieren, das Rektorate hindere, „Führung“ zu zeigen, indem sie beispielsweise bestehende Fächerstrukturen zerschlagen, um finanzielle Ressourcen mit Blick auf Wettbewerbserfolge flexibel zu verschieben.[2] Im Klartext bedeutet dies, dass Wissenschaftsfreiheit den Governanceinstanzen, nicht den Wissenschaftler:innen zuzukommen hat, und es impliziert die Anforderung, mit maximaler Flexibilität über abhängiges Personal zu verfügen.
Die strukturelle Entdemokratisierung, die an den Universitäten in den vergangenen zwei bis drei Jahrzehnten stattgefunden hat, lief deshalb unter dem Radar einer breiten Öffentlichkeit, weil sie an der Funktionsfähigkeit von Wissenschaft nichts zu ändern schien und man sogar glaubte, dass diese vom Exzellenzprinzip profitiert. Wissenschaftsfreiheit als demokratisches und kulturelles Gut ist mit der Machtkonzentration auf immer kleinere Gruppen und immer enger definierte Instanzen jedoch nicht kompatibel. Sie kann nur in einem Umfeld gedeihen, das eine freie Diskussion unter grundsätzlich Gleichberechtigten gewährleistet und Vielfalt ermöglicht: Originelle Forschung und konstruktive wechselseitige Kritik setzen langfristigen Kompetenzaufbau voraus und profitieren von hierarchiearmen Strukturen; beides erfordert sichere Positionen für möglichst große Gruppen von Beschäftigten. Dass dies der Sinn von academic tenure ist, erschien einmal als gesicherter Grundsatz und scheint dennoch vergessen worden zu sein; im deutschen Wissenschaftssystem wurde intensiv daran gearbeitet, es vergessen zu machen.
Was diese Entwicklung zur Folge hätte, wenn die freiheitlich-demokratische Grundordnung des gesamten Landes angegriffen wird, lässt sich leicht ausmalen. Es würde genügen, Universitäten den Geldhahn zuzudrehen, um sie in kürzester Zeit funktionsunfähig und damit politisch erpressbar zu machen, da ja ein großer Teil des wissenschaftlichen Personals disponibel und nur eine Minderheit beamtenrechtlich geschützt ist. Dass das bei Institutionen wie Museen und Theatern bereits jetzt geschieht, wenn sie demokratiefeindlichen Kräften wie der AfD als unliebsam erscheinen und diese die Möglichkeit dazu haben, sollte auch der Wissenschaft als dringendes Warnsignal gelten.[3] Vor diesem Hintergrund klingen die Bekenntnisse zu Demokratie und Vielfalt, die Wissenschaftsinstitutionen wie die Hochschulrektorenkonferenz (HRK) in jüngster Zeit mit Verve vorgetragen haben, überaus wohlfeil. Gegen antidemokratische Tendenzen ist mit schönen Worten noch kein effektiver Schutz geleistet. Um Wissenschaftsfreiheit wirklich zu sichern – im Normalbetrieb, aber um wieviel mehr noch im politischen Notfall –, wären zwei Dinge nötig: Erstens muss Wissenschaftsfreiheit als kollektives Gut verstanden werden, das nur in kollektiver Selbstkontrolle wirksam ausgeübt werden kann. Das bedeutet, dass zu ihren Ermöglichungsbedingungen die Entwicklung vielfältiger individueller Forschungsprogramme gehört. Wer dies versteht, darf Forschende nicht bis in ihr mittleres Lebensalter in Positionen halten, die die dafür notwendige Eigenständigkeit und Selbstbestimmtheit behindern, und darf Vielfalt nicht durch erzwungene Karriereabbrüche einschränken. Zweitens ist ein auf die Maximierung persönlicher Abhängigkeiten angelegtes System auch intern nicht gegen politische Gefahren gesichert. Wie leicht es sein kann, ein Universitätssystem politisch gleichzuschalten, hat sich in Deutschland historisch bereits erwiesen. Ist dieses System aber strukturell so angelegt, dass es nur einer relativ kleinen Personengruppe bedarf, um Herrschaftsverhältnisse im entsprechenden Sinne auszunutzen, ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich die Freiheit der Forschung mindestens partiell bewährt, umso geringer.
Wissenschaftsfreiheit, politische Debatte und staatlich begrenzte Redefreiheit – der Nahostkonflikt und die Stellung nichtdeutscher Wissenschaftler:innen
Zugleich ist die Wissenschaftsfreiheit auch direkt gefährdet, wenn der Raum des öffentlich Sagbaren eingeschränkt und die Möglichkeit wissenschaftlicher Betätigung davon abhängig gemacht wird, ob die Gesamtheit persönlicher Meinungsäußerungen in einem als akzeptabel abgesteckten Bereich bleibt. Besonders spürbar wird das für diejenigen, die nicht schon immer im deutschen Wissenschaftssystem tätig waren. Die behauptete Weltoffenheit und Bereitschaft, politisch verfolgten oder ihrer Existenzgrundlagen beraubten Forschenden Zuflucht zu gewähren, ist nicht allein dadurch begrenzt, dass gerade für diese Personengruppen zumeist nur kurzfristige Finanzierungen verfügbar gemacht werden. Angesichts der Streitigkeiten um den Nahostkonflikt sehen sich zudem insbesondere Gaststudierende, ausländische Forschungsgäste, eingewanderte und geflüchtete Wissenschaftler*innen mit vielfältigen Sanktionsdrohungen konfrontiert, wenn sie sich in unerwünschter Weise äußern und politisch betätigen. Die Praxis freien wissenschaftlichen Austauschs ist in diesem Feld bereits lange und nicht nur von institutioneller Seite durch Gesprächsverweigerungen beeinträchtigt,[4] zu denen vermehrt Gewaltbereitschaft, rassistische und antisemitische Übergriffe kommen. Sanktionen zielen aber nur fallweise darauf, solche Handlungsweisen zu unterbinden, um etwa jüdische Studierende zu schützen. Vielmehr beschränken die akademischen Institutionen selbst den Raum akzeptabler Äußerungen und Personen. Von Forensic Architecture bis zu Nancy Fraser wurden namhafte Gruppen und Personen akademisch ausgeladen, und auch längerfristige Gastverträge erweisen sich als politisch kündbar. Im Umfeld häufen sich weniger prominente Veranstaltungsverbote, Ausladungen, vorgreifende Absagen und öffentliche Kampagnen gegen Eingeladene, Vorab-Aushandlungen sensibler Vortragsthemen sowie Überprüfungen des politischen Profils möglicher Kooperationspartner. Die Neigung der deutschen Behörden, Debattenbeteiligte wie Yanis Varoufakis erst gar nicht mehr einreisen zu lassen,[5] verstärkt den Eindruck, dass eine offene Diskussion nicht erwünscht ist.
Der politische Horizont dieser Streitigkeiten ist offiziell durch das unstrittige und gerade heute unverzichtbare Prinzip definiert, dass antisemitische Äußerungen und Handlungen in Deutschland keinen Platz haben dürfen. In den einschlägigen Bekundungen wird jedoch häufig Israelkritik vorschnell diskreditiert und per se mit Antisemitismus identifiziert. Beispiele sind die mit Bezug auf Fördergelder beschlossene Verurteilung der stark umstrittenen Kampagne Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) als insgesamt antisemitisch durch den deutschen Bundestag[6] sowie der Gebrauch der Antisemitismus-Arbeitsdefinition der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Obwohl vielfältig dargelegt wurde, dass diese Definition nicht für wissenschaftliche Kontexte und für rechtliche Verwendungen geeignet ist, weil sie etwa auch Kritik am Staat Israel als antisemitisch einzuordnen erlaubt,[7] besteht auf der Ebene der Hochschulleitungen zunehmend Bereitschaft, sie zur Kontrolle akademischer Tätigkeit einzusetzen.[8] Im Bereich der Fördergelder, die auch ohne gerichtsfeste Begründung gewährt, verweigert oder zurückgezogen werden können, sind Einschränkungen besonders leicht durchzusetzen.
Die Fragen, welche Solidarität Israel gebührt, welche Äußerungen antisemitisch sind und bei welchen Positionen die Redefreiheit aufhören muss, verdienen intensiv und konfliktoffen diskutiert zu werden. Gerade deshalb muss der politische wie auch der wissenschaftliche Diskurs jedoch vielfältig sein. Die Marginalisierung und Diskreditierung kritischer bzw. von der offiziellen Position der Bundesregierung, der Landesregierungen und des Bundestags abweichender Stimmen birgt grundlegende Gefahren für die Zukunft ernstzunehmender wissenschaftlicher Praxis in Deutschland. Zum einen widerspricht die Auferlegung weniger, vorgeschriebener Einschätzungen und Definitionen wie der BDS-Verurteilung oder der IHRA-Definition dem Prinzip wissenschaftlicher Forschung, verschiedene Ansätze kritisch gegeneinander im Gespräch zu halten und fest etablierte Begriffe und Positionen infrage zu stellen. Zum anderen schüchtert die zunehmend autoritäre oder mindestens den Diskurs scheuende Haltung wissenschaftlicher Einrichtungen in Deutschland insbesondere ausländische Studierende und Forscher:innen ein und beeinträchtigt zusätzlich die internationale Offenheit, die u.a. durch ein ungastliches soziales Klima und die feudal-klientelistischen Anstellungspraktiken an deutschen Hochschulen ohnehin deutlich hinter anderen führenden Wissenschaftsländern wie England oder den USA liegt. In der internationalen Wahrnehmung gilt Deutschland angesichts der geschilderten Entwicklungen zunehmend als Ort, an dem kritische Wissenschaft generell unerwünscht ist. Das Problem, zu klären, unter welchen Bedingungen der akademische Raum in der Auseinandersetzung über Israel und Palästina nicht nur als Bühne für Proteste und Staatsmacht, sondern auch für den Austausch von Argumenten genutzt werden kann, besteht auf absehbare Zeit nicht nur hier.
Resümee: Wissenschaftsfreiheit als gefährdete Praxis
Die Bedingungen für freien und kritischen wissenschaftlichen Austausch verschlechtern sich auch jenseits der geschilderten Fronten. Sie werden auch von denen angegriffen, die Wissenschaft vorgeblich verteidigen, aber zugleich ganze Wissenschaftsrichtungen wie die Geschlechterforschung oder post- und dekoloniale Forschung zu diskreditieren versuchen. Selbst die sprachlichen Konventionen kritischer Wissenschaft sind den Angriffen rechter Parteien ausgesetzt, wenngleich es den Bundesländern bislang gesetzlich nicht möglich ist, geschlechtergerechte Sprache in wissenschaftlichen Texten zu untersagen.
Grundsätzlich bleibt festzuhalten, dass Wissenschaftsfreiheit als Praxis gefährdet ist, wo immer Wissenschaftler:innen als Akteure prekär gestellt sind und untergeordnet bleiben. Das gilt für befristet beschäftigtes wissenschaftliches Personal ebenso wie für nichtdeutsche Wissenschaftler:innen, und es zeigt sich gleichfalls, wenn die Institutionen akademischer Selbstverwaltung hierarchisch bleiben oder fortschreitend zugunsten managerialer Hochschulleitungen und inszenierter Wettbewerbe ausgehöhlt werden. Unter diesen Bedingungen fehlt den meisten Beteiligten der nötige institutionellen Rückhalt, um ihre wissenschaftliche Neugier zu entfalten, sich kritisch gegen Etablierte einzubringen, politische Impulse in die Wissenschaft einzuspeisen und autoritäre Eingriffe abzuwehren. Zentrale Bedrohungen der Wissenschaftsfreiheit kommen also nicht einfach von außen. Sie liegen in den Strukturen des deutschen Wissenschaftssystems selbst.
Fußnoten
[1] Mathias Kuhnt, Tilman Reitz, Patrick Wöhrle: Arbeiten unter dem Wissenschaftszeitvertragsgesetz Eine Evaluation von Befristungsrecht und -realität an deutschen Universitäten, Dresden 2022, S. 82 f. https://tud.qucosa.de/landing-page/?tx_dlf[id]=https%3A%2F%2Ftud.qucosa.de%2Fapi%2Fqucosa%253A80511%2Fmets
[2] “Deutschen Unis fehlt es an Mut!” DIE ZEIT Nr. 6/2016, 4. Februar 2016.
[3] Siehe zur Zukunft des Tucholsky-Museums in Rheinsberg https://taz.de/Tucholsky-Museum-in-Rheinsberg/!6001781/, sowie die Position der AfD zum gemeinnützigen Theater in Eisenach https://www.thueringer-allgemeine.de/regionen/eisenach/article227886641/AfD-lehnt-Zuschuss-fuer-Theater-am-Markt-ab.html.
[4] Vgl. für die Vorgeschichte der aktuellen Gesprächsblockaden die Beispiele bei Meron Mendel, Über Israel reden. Eine deutsche Debatte, Köln 2023.
[5] Den Kontext bildete der umstrittene und dann gleich zu Beginn aufgelöste „Palästina-Kongress“ in Berlin https://www.fr.de/politik/yanis-varoufakis-news-krieg-in-israel-hamas-palaestina-kongress-berlin-einreiseverbot-fuer-93017945.html.
[6] Deutscher Bundestag, Drucksache 19/10191, 15.5.2019 https://www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2019/kw20-de-bds-642892.
[7] Vgl. https://www.rosalux.de/publikation/id/41168/gutachten-zur-arbeitsdefinition-antisemitismus-der-international-holocaust-remembrance-alliance/ und https://verfassungsblog.de/die-implementation-der-ihra-arbeitsdefinition-antisemitismus-ins-deutsche-recht-eine-rechtliche-beurteilung/
[8] Die Hochschulrektorenkonferenz hat sich diese Definition bereits 2019 zu eigen gemacht, und im Gefolge des 7. Oktober 2023 will etwa die Berliner Landesrektorenkonferenz mit ihrer Hilfe Antisemitismus an den Hochschulen bekämpfen.https://www.lkrp-berlin.de/aktuelles/231106-kein-platz-fuer-antisemitismus/index.html