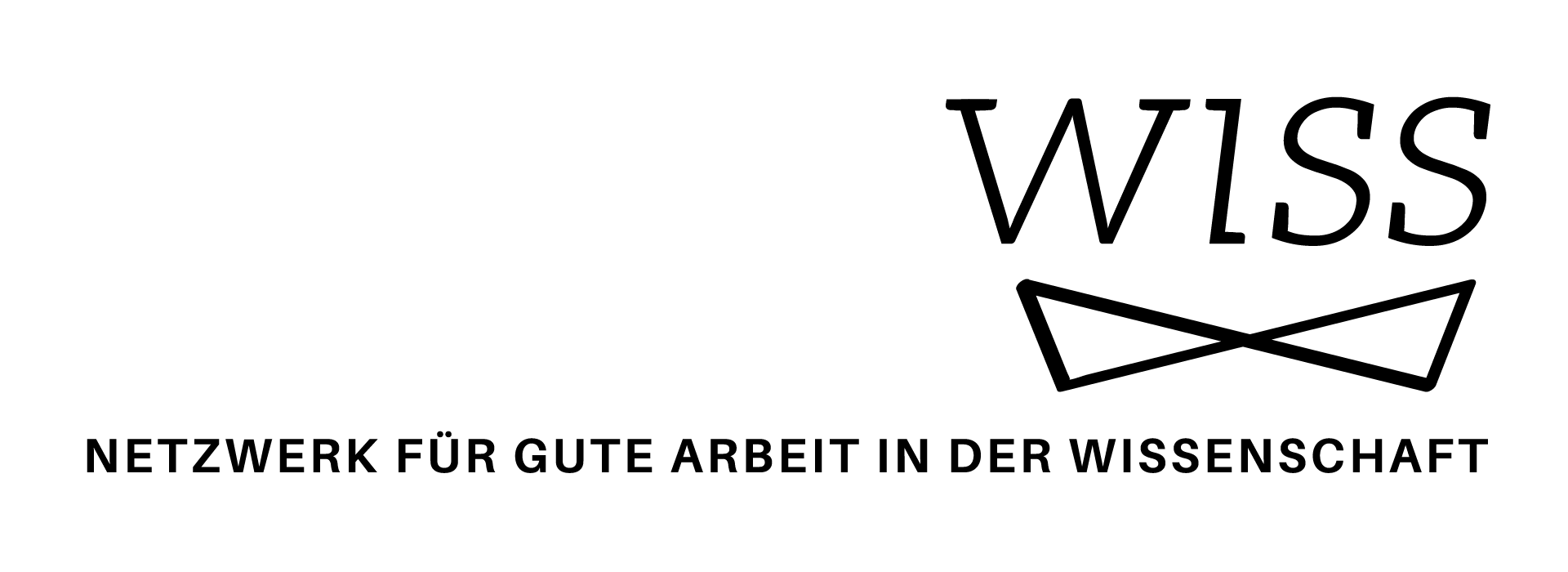09 Dec Scheinwahrheit Nr. 6b: Wissenschaftlich arbeiten und sich damit selbst verwirklichen zu können, ist doch ein Geschenk. Da sollte man dankbar sein, wenn es einem zumindest für eine Weile auch bezahlt wird.
Link zur Scheinwahrheit kopieren.
Folgte man dieser Behauptung, müsste man schon im Schritt vorher die Existenz von Universitäten als ein Geschenk des Staates an die Gesellschaft ansehen – also als etwas, das er nur aus Freundlichkeit oder Luxus gewährt und worauf er ggf. auch verzichten könnte. Das sind sie aber nicht: Sie erfüllen eine wichtige gesellschaftliche Rolle, und zwar keineswegs nur oder primär für die Generierung transferfähiger, ökonomisch verwertbarer Erkenntnisse, wie in der Politik zurzeit regelmäßig suggeriert wird (vgl. auch Scheinwahrheit 2a), sondern zum Erhalt und zum Aufbau des gesamtgesellschaftlichen Wissens- und Reflexionsniveaus. Wie gegenwärtig besonders dringlich zu betonen ist, schließt Letzteres sowohl breite Kenntnis der Mechanismen wissenschaftlicher Erkenntnisprüfung als auch die Fähigkeit ein, gesellschaftlich-politische Entwicklungen kritisch zu bewerten (vgl. auch Scheinwahrheit 10a). Um diese Fähigkeit breit zu verankern, muss auch die Schulbildung deutlich gestärkt werden. Dies setzt eine hervorragende und kontinuierliche Lehrer:innenbildung voraus.
Wissenschaft ist ein Beruf und kein Hobby. Ihr Funktionieren ist auf stetig aufgebaute und kontinuierlich in der Praxis geprüfte Expertise angewiesen, deren Entwicklung und Erhalt vom Staat ermöglicht werden muss. Sollen die Universitäten also diese notwendigen Aufgaben erfüllen, darf erwartet werden, dass dies unter Bedingungen geschieht, die 1. wissenschaftliche Autonomie statt Abhängigkeit von Vorgesetzten und Anpassungszwang durch den Drittmittelbetrieb (vgl. Scheinwahrheit 8b) garantieren und 2. Gesundheit und Arbeitskraft von Wissenschaftler:innen nicht systematisch verschleißen. (Dazu, dass dies im gegenwärtigen Wettbewerbsbetrieb der Fall ist, siehe Neckel und Wagner, Leistung 2013 sowie Schmidt, Burnout 2016.) Wer suggeriert, es handle sich bei der Forschung um eine Summe temporärer individueller Selbstverwirklichungsprojekte, macht sich und andere blind dafür, dass dies Aufbau und Erhalt solcher Expertise systematisch behindert. Dass Wissenschaftler:innen sich zugleich auch selbst verwirklichen oder Freude an der Wissenschaft empfinden, ändert nichts daran, dass sie gleichzeitig auch ihren Lebensunterhalt (und den ihrer Familie) verdienen müssen. Wissenschaft ist ein Beruf – und daran hängen materielle Existenzen. Dass wissenschaftliche Arbeit sich unter den gegenwärtigen Bedingungen so oft als schädlich für die physische und mentale Gesundheit von Wissenschaftler:innen erweist, ist eine paradoxe Folge davon, dass viele sich das Narrativ von Wissenschaft als Selbstverwirklichung zu eigen machen: Psychische und physische Grenzen werden dadurch nicht erkannt oder bewusst übergangen. Darunter leidet auch die Qualität des wissenschaftlichen Outputs, denn wissenschaftliche Erfolge werden durch Kopfarbeit produziert. Sie von ständig kurz vor dem Burnout stehenden Arbeitskräften erbringen zu lassen, ist offensichtlich sinnlos.
Alles in allem scheint der obigen Behauptung die Vorstellung zugrunde zu liegen, dass Spaß an der Arbeit nur haben dürfe, wer im Gegenzug mit prekären Arbeitsbedingungen dafür bezahlt. Leider beweist das aktuelle System, in welchem Maße es sich dabei tatsächlich um eine ausbeutbare Ressource handelt.
Literatur:
– Neckel, Sighard und Greta Wagner (Hrsg.) Leistung und Erschöpfung: Burnout in der Wettbewerbsgesellschaft, Berlin 2013.
– Schmidt, Franziska, Burnout und Arbeitsengagement bei Hochschullehrenden. Der direkte und interagierende Einfluss von Arbeitsbelastungen und -ressourcen. Wiesbaden 2016.
Zurück zur Übersicht ‘Argumentationshilfen’