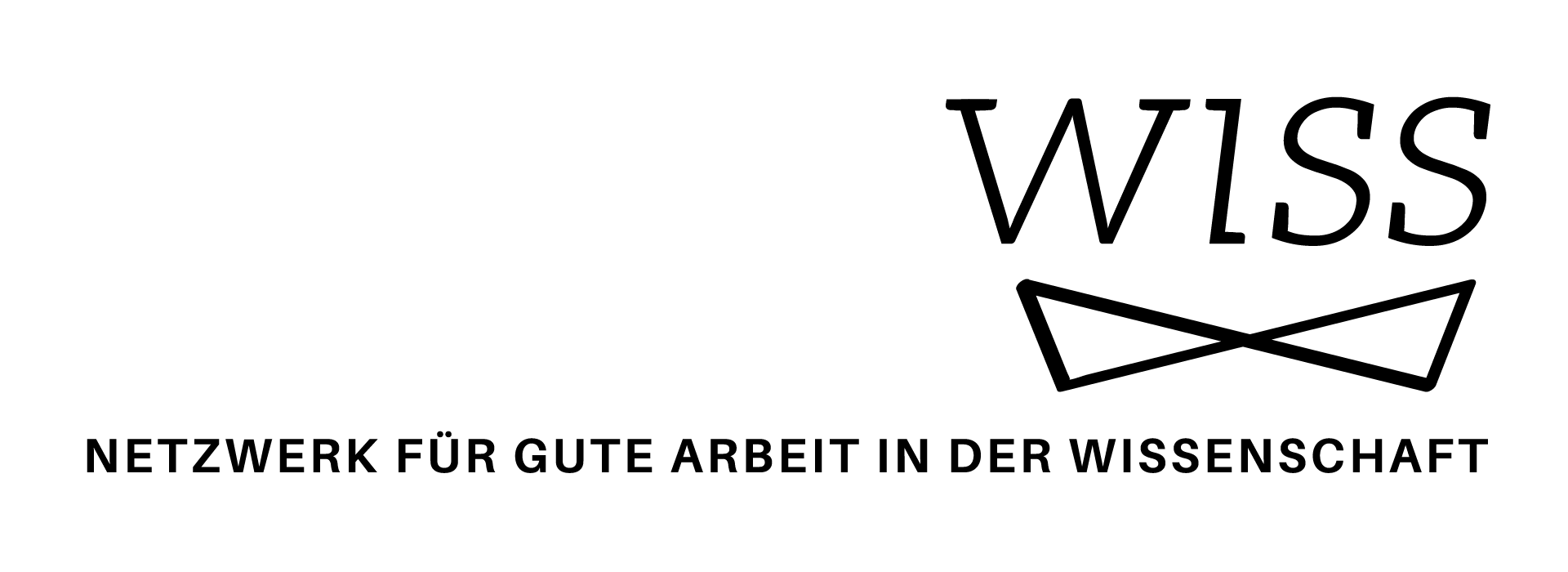10 Dec Scheinwahrheit Nr. 8c: Ohne befristete Mittelbaustellen als ‚Ausstattung‘ sind Professuren für Spitzenpersonal nicht mehr attraktiv – schließlich wollen diese Leute ihre Teams selbst bilden. Solch einen Wettbewerbsnachteil können sich Universitäten nicht leisten.
Link zur Scheinwahrheit kopieren.
Diese Behauptung wird gern mit Blick auf internationales Spitzenpersonal formuliert und macht sich schon damit meist unglaubwürdig, weil es das deutsche Lehrstuhlsystem mit seinen abhängigen, befristeten Qualifikationsstellen außerhalb deutschsprachiger Länder praktisch nicht gibt. Attraktiv dürfte es daher insbesondere Abgewanderten aus diesen Ländern erscheinen, die das deutsche System von früher gewohnt sind. Mutmaßlich weniger attraktiv ist es dagegen für Forschende, die – wie in den USA – von deutlich geringeren Lehrdeputaten und folglich mehr Forschungszeit profitieren. Daher drängt sich der Verdacht auf, dass die vermeintlich attraktiven Lehrstuhlpositionen weniger der Internationalisierung als der Provinzialisierung des deutschen Wissenschaftsstandortes dienen. Gefragt werden darf auch, ob der Forschungsstandort Deutschland vor allem für den Wissenschaftlertyp attraktiv sein soll, der es vorzieht, abhängiges Personal mit schlechten Karriereaussichten anzuweisen (vgl. Scheinwahrheit 8b) als selbst forschen zu können. Die eigenen Mitarbeiter:innen alle paar Jahre austauschen zu wollen, bedeutet auch, Verantwortung für deren prekäre Anschlussperspektiven von sich zu weisen. Bisweilen geht damit auch eine gewisse Einkaufsmentalität einher: Man will sich die Kompetenzen holen, die sich für das eigene Forschungsinteresse gerade nutzbar machen lassen, nimmt zugleich aber die Verpflichtung an, die betreffenden Personen im Sinne ihres bestmöglichen eigenen Fortkommens zu qualifizieren.
Das in der obigen Behauptung vorausgesetzte ‚Spitzenpersonal‘ ist implizit schon als hierarchisch und konkurrenzorientiert denkendes charakterisiert. Warum sollten verantwortungsvolle Positionen nicht gerade mit solchen Persönlichkeiten besetzt werden, denen eine größere Auswahl möglicher Kooperationspartner:innen auf Augenhöhe, als sie sie im gegenwärtigen System vorfinden, für langfristige Forschungsvorhaben attraktiver erscheint? Auch innerhalb der Departments oder Institute hätte eine gleichberechtigtere Struktur viele Vorteile: Aufgaben in akademischer Selbstverwaltung könnten auf mehr Schultern verteilt werden und der ständige Aufwand für die Wiederbesetzung von Stellen fiele weg.
Da das obige Argument zuletzt besonders häufig gegen das reformierte Berliner Hochschulgesetz ins Feld geführt wurde, sei betont: Von einem Wettbewerbsnachteil kann nur solange gesprochen werden, wie deutschlandweit uneinheitliche Verhältnisse herrschen. Doch so, wie in anderen Bereichen – etwa Gesundheitsökonomie oder Arbeitsvermittlung – mittlerweile erkannt wurde, wie häufig Kennzahlenwettbewerbe lediglich Unterbietungskonkurrenz in der Qualität von Leistungen bedeuten, sollte in der Wissenschaft sich die Einsicht durchsetzen, dass die Kehrseite von Überbietungskonkurrenzen in Sachen ‚Ausstattung‘ lediglich ein Unterbietungswettbewerb in Jobsicherheit und Karrierechancen für die abhängig Beschäftigten ist. Eine grundlegende Reform des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG) könnte hier Abhilfe schaffen: Vereinheitlichung braucht nicht im Sinne kollektiver Verantwortungsverweigerung zu geschehen.
Zurück zur Übersicht ‘Argumentationshilfen’