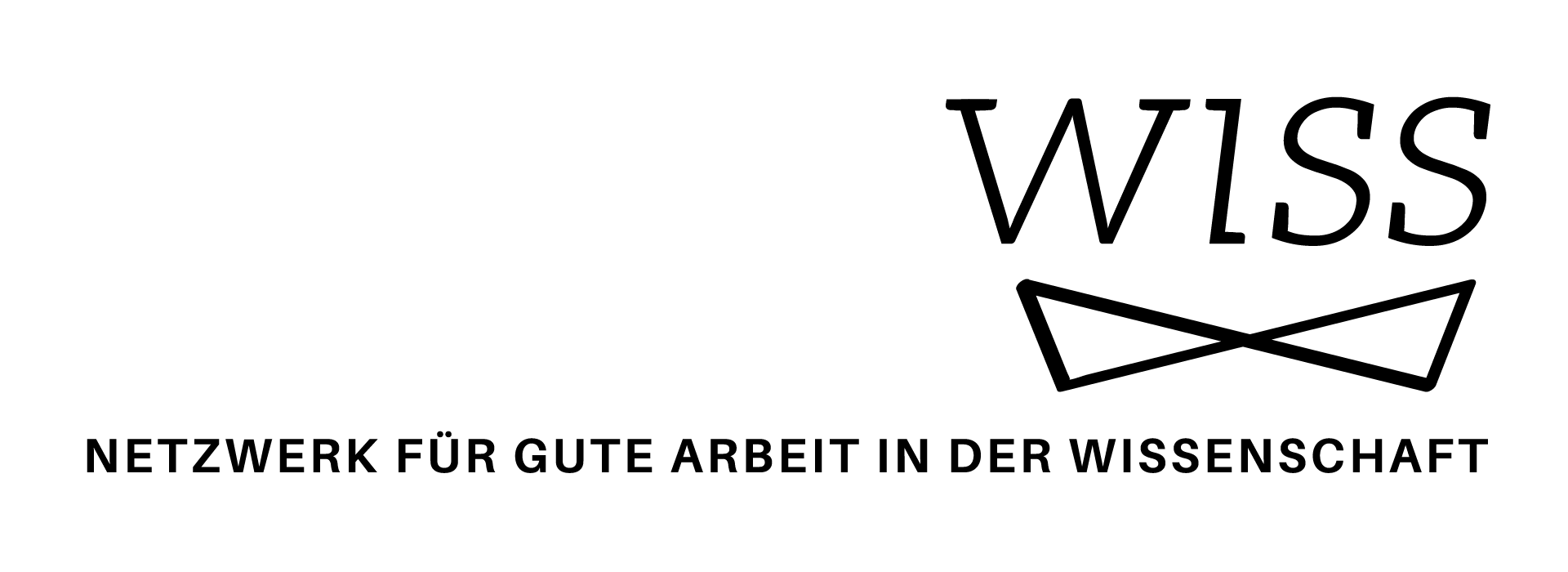Statements
SOZIOLOGIN UND GEWERKSCHAFTERIN DR. ANNE K. KRÜGER (GEW)
Das Netzwerk Gute Arbeit in der Wissenschaft hat einen beeindruckenden Aufschlag unternommen, rechnerisch nachzuweisen, wie man auf verschiedenen Wegen nahezu kostenneutral die Personalstruktur des deutschen Wissenschaftssystems umbauen könnte. Und auch das Ziel, das damit verfolgt wird, halte ich für das zentrale Ziel: nämlich erstens deutlich zu machen, dass das derzeitige System darauf basiert, dass „die Karrierechance der Nachfolgenden die massenhafte Entsorgung der Vorgänger*innen voraussetzen“ (S.2). Und zweitens die Frage zu stellen, wie „die personelle Dynamik eines Systems aussähe, das wissenschaftlichen Nachwuchs in vertretbarer Zeit für unbefristete Stellen ausbilden würde“ (ebd.).
Dazu hat das NGAWiss erstmals in seiner Rechnung vier entscheidende Faktoren berücksichtigt, die genau darüber Auskunft geben können:
– die Personaldynamik: Wie viele Dauerstellen können jeweils jährlich neu besetzt werden?
– die Neuzugänge: Wie viele Menschen können pro Jahr erstmals in der Wissenschaft eine Beschäftigung aufnehmen?
– die Übergangsquoten: Wie viele Personen können jährlich nach der Promotion eine Postdok-Stelle antreten?
– und auch die erzwungenen Austritte aus der Wissenschaft: Wie viele Postdoks müssen jährlich das System verlassen, weil es keine Stellen für sie gibt?
Die Rechnungen dazu basieren auf bestimmten Prämissen, die einerseits interessante Vorschläge sind (wie beispielsweise Drittmittel als Grundmittel mit einzubeziehen), aber auch gewisse Probleme bergen (wie beispielsweise bei der Länge der Promotionsstellen mit 5 Jahren unter den Möglichkeiten des WissZeitVG zu bleiben und lediglich von 80%-Stellen
auszugehen). Das Papier arbeitet dann verschiedene Personalstrukturmodelle heraus, wobei man eine gewisse Tendenz zu einem reinen Lecturer-Modell herauslesen kann.
Die Frage nach einer Reform der Personalstruktur an Universitäten wird dabei aktuelle zunehmend zum Thema der Stunde. In einer Studie zu den Personalentwicklungskonzepten, die im Rahmen des TT_Programms eingereicht wurden, die ich gerade – finanziert durch die GEWnahe Max-Traeger-Stiftung – durchgeführt habe (1), wird deutlich, dass Dauerstellen neben der Professur zu einem relevanten Thema werden und an einigen Unis auch tatsächlich über Reformen ihrer Personalstruktur nachgedacht wird.
Und die GEW hat in ihrem Positionspapier „Wissenschaft als Beruf“(2), das wir vor drei Jahren bereits auf einer Veranstaltung zusammen mit dem NGAWiss vorgestellt haben, Vorschläge vorgelegt, wie eine Personalstruktur mit entsprechenden Stellenkategorien aussehen könnte, die einerseits Qualifizierung ermöglicht und andererseits der Vielzahl an Aufgaben an den Universitäten gerecht wird. Als wesentliche Voraussetzung wurde hier vor allem eine Departmentstruktur stark gemacht, die sowohl Dauerstellen neben der Professur vorsieht als auch frühzeitige Eigenständigkeit ohne die Abhängigkeit von Lehrstuhlinhaber*innen.
Die Fragen von Qualifizierung einerseits und Daueraufgaben andererseits sind hierbei die zentralen Fragen dafür, wie eine Personalstruktur aussehen sollte. Und die Vermischung dieser beiden Punkte in der aktuellen Personalstruktur stellt das entscheidende Problem dar. Denn die Auslagerung einer Vielzahl an Daueraufgaben auf Qualifizierungsstellen verhindert zu sehen, wie viele Daueraufgaben an den Unis bestehen. Die GEW geht an dieser Stelle auch noch einen Schritt weiter, indem sie darauf hinweist, dass nicht nur z.B. Studienberatung, Erasmuskoordination oder die Betreuung von Großgeräten und Sammlungen als Daueraufgaben verstanden werden müssen, sondern gerade auch Lehre und Forschung die Kern- und damit Daueraufgaben einer Universität sind.
Es geht hier also einerseits um die Frage, wie individuellen Wissenschaftler*innen endlich langfristige Jobperspektiven angeboten werden können. Es geht dabei aber andererseits auch um die Frage, wie die Universitäten eigentlich der permanent wachsenden Anzahl an Daueraufgaben, die an ihnen stattfinden müssen, gerecht werden wollen.
Wenn es also um die Entwicklung einer Personalstruktur geht, muss man unbedingt auch danach fragen, was die Aufgaben einer Universität inklusive Lehre und Forschung sind und wieviel Personal auch jenseits der Professuren, mit denen man bislang vor allem rechnet, man eigentlich dafür benötigt.
Und dann muss man sich in einem zweiten Schritt wiederum fragen, wieviel befristete Promotionsstellen man braucht, um hier sowohl permanent eine adäquate Nachbesetzung im Wissenschaftssystem zu ermöglichen, als auch – wie es immer heißt – für Positionen in Wirtschaft und Gesellschaft zu qualifizieren.
Das hat natürlich mit Geld zu tun. Und das NGAWiss-Papier gibt wichtige Impulse dahingehend, dass ein solcher Umbau nicht am Geld scheitern muss. Es hat aber auch mit einer adäquaten Personalplanung und Personalstrukturentwicklung zu tun. Und dazu sollten die Universitäten dringend endlich kommen.
Dafür setzt sich die GEW aktuell mit ihrer Petition „Dauerstellen für Daueraufgaben“ ein, die auf der Website der GEW zu finden ist.
PHILOSOPH UND MITTELBAUVERTRETER DGPhil DR. DANIEL KERSTING
Das vorliegende Diskussionspapier ergänzt die bisher geführte Debatte um Personalmodelle an Universitäten in Deutschland um mindestens drei wichtige Punkte: Es räumt erstens das verbreitete Bedenken aus, Entfristungspolitik ginge grundsätzlich zulasten folgender Generationen, weil für diese nicht mehr genügend Stellen frei würden. Demgegenüber zeigen die Rechnungen: auch Dauerstellen-Modelle ermöglichen viele Neuzugänge; sie schaffen – zumindest dann, wenn von einer deutlich geringeren Zahl an Promovierenden ausgegangen wird – bessere Anschlussmöglichkeiten, erzwingen also weniger Ausstiege aus der Wissenschaft. Zweitens erweitert das Papier die bisherige Diskussion, die sich in den letzten Jahren vor allem auf das Tenure-Track-Modell fokussiert hat, um neue Entfristungsperspektiven und zeigt damit klar: Es gibt weit mehr als eine gute Alternative zum Status quo. Schließlich berücksichtigt das Papier drittens bei der inhaltlichen Diskussion der Vor- und Nachteile der Modelle neben quantitativen Aspekten auch qualitative Gesichtspunkte: Die Autor*innen fragen weniger danach, wie viel Arbeitskraft die jeweiligen Modelle für Drittmittelakquise oder internationale Wettbewerbsfähigkeit freisetzen. Ihr Fokus liegt eher darauf, ob die entsprechenden Personalreformen sozial integrativ oder exkludierend wirken würden, wie anfällig sie für die Entstehung neuer Macht- und Abhängigkeitsverhältnisse wären und ob sie dabei helfen könnten, strukturelle Diskriminierung in den Wissenschaften abzubauen. Damit macht das Papier auf eine gesellschaftliche Dimension unserer Diskussion um Personalmodelle aufmerksam und erinnert an die gesellschaftspolitische Verantwortung der Hochschulen.
Wirft man unter dieser Perspektive einen vergleichenden Blick auf die vorgestellten Modelle, kommen u.a. folgende Aspekte in den Blick: Professurenzentrierte Modelle wie das Tenure-Track-Modell (hier Variante B) oder das reine Professuren-Modell (Variante D) schaffen größere Gleichheit und damit möglicherweise auch mehr Gleichberechtigung innerhalb des Kollegiums, indem sie auf die Abschaffung des (abhängig beschäftigen) Mittelbaus zielen und allen wissenschaftlich Beschäftigten nach der Promotion selbständige Forschung und Lehre ermöglichen. Sieht man einmal von der Abhängigkeit ab, in der jene stehen, die sich noch auf dem „Track“ befinden, sind diese Modelle in Sachen Autonomie und Egalität unschlagbar. Auf der anderen Seite verlangen sie den Individuen aber auch eine ganze Reihe von Anpassungsleistungen ab: ein System, das mit weniger Personal auskommt und alle Karrierewege auf die Professur konzentriert, ist mit hoher Wahrscheinlichkeit kompetitiver und sozial selektiver als ein System mit heterogenen Stellenprofilen und quantitativ mehr Stellen. Bildungsbiographien würden dadurch noch stärker normiert als bisher und Diversität an der Hochschule faktisch abgebaut. Das Lecturer-Modell oder verwandte Modelle haben diese Konsequenzen nicht, weil sie mit Dauerstellen jenseits der Professur unterschiedliche Beschäftigungsmöglichkeiten bieten und damit auch eine größere Pluralität an Berufsbiographien zulassen. Dafür sind sie anfälliger für die Bildung neuer Hierarchien, in denen unliebsame Aufgaben leichter ‚nach unten‘ gereicht werden können und sich längerfristig auch eine Kluft zwischen reinen Lehrstellen und reinen Forschungsstellen herausbilden könnte.
Aus der Antizipation solcher möglichen Konsequenzen folgt freilich noch nicht unmittelbar, welches Modell das bessere ist. Das ist eine evaluative Frage, deren Beantwortung auch politische und ethische Wertentscheidungen einschließt: etwa darüber, ob man ein kleines, gleichberechtigtes, aber dafür tendenziell elitäreres Institut für wünschenswert erachtet, oder ein größeres Institut mit einer heterogeneren Personalstruktur. Oder darüber, ob wir Hochschulen primär als „Forschungsstandorte“ verstehen möchten, an denen unter marktförmigen Bedingungen Wissen produziert wird, oder als Bildungsinstitutionen, die Individuen in umfassende (Selbst-)Bildungsprozesse einbinden – Prozesse, die letztlich auch für den Erhalt einer lebendigen Demokratie unverzichtbar sind.
Natürlich sollte der Streit um das „richtige“ Modell die gemeinsamen Bemühungen um eine Verbesserung der Situation an den Universitäten nicht spalten. Bei allen Unterschieden im Detail verfolgen doch alle Modelle das Ziel, möglichst vielen nach der Promotion eine unbefristete Anstellung zu ermöglichen. Politisch erscheint es sinnvoll, dieses gemeinsame Ziel immer wieder ins Zentrum von Debatten und Verhandlungen zu stellen. Möglicherweise zeigt sich in der Umsetzung, dass gerade mit Blick auf Interessensgegensätze Lecturer-Modelle anderen Modellen gegenüber überlegen sind, weil sie flexibler ausgestaltet werden können und dadurch leichter als andere Modelle Kompromissbildungen ermöglichen. Dies wird freilich die weitere Diskussion zeigen müssen, die nun vor allem an den Instituten und Fachbereichen vor Ort zu führen wäre – unter Einbeziehung aller Interessens- und Statusgruppen und unter Berücksichtigung der jeweiligen institutionellen Bedingungen und Fachkulturen.
Weitere Kommentare zu unserem Diskussionspapier können gern per Mail an uns gerichtet werden!